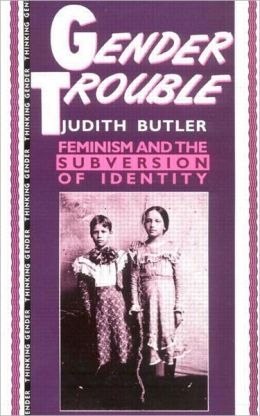Frauen- und Geschlechterforschung
Lange Zeit – bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert - bildeten Frauen in den hehren Hallen der Wissenschaft die Ausnahme. Dieser Ausnahme-Status forderte sie zunächst dahingehend heraus, die Berechtigung ihrer Zugehörigkeit unter Beweis zu stellen. Elise Richter, eine der ersten Studentinnen, Doktorinnen und erste habilitierte Frau an der Universität Wien in ihrer Autobiographie: „Als Frau habe ich jedenfalls so viel gegeben als empfangen. Ich empfing den Weg, was gewiss nicht gering zu schätzen ist, aber ich ging ihn, und hier darf ich wohl sagen, in vorbildlicher Weise.“ Kritik an der männlich dominierten Wissenschaft zu üben blieb einer späteren Zeit und den nächsten Generationen vorbehalten, in der sich die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse verändert hatten. Dementsprechend ging der quantitative Aufbruch der Frauen im tertiären Bildungssektor in den 1960er und 70er Jahren mit einem qualitativen im Bereich der Wissenschaften Hand in Hand.
Wie männlich ist die Wissenschaft?
Mit ihrer Publikation „Wie männlich ist die Wissenschaft?“ stellten Karin Hausen und Helga Nowotny als Herausgeberinnen stellvertretend für viele andere Wissenschafterinnen diese Mitte der 1980er Jahre zentrale Frage und setzten einen Metalog in Bewegung. Die Wissenschaftsproduktion wurde hier ebenso beleuchtet wie die unterschiedlichen Bedingungen und Erfahrungen der im Wissenschaftsbetrieb Agierenden, die sich am Bild des zerstreuten, den Dingen des Alltags entkoppelten und nur für die Wissenschaft lebenden Professors abzuarbeiten hatte. In diesen Vorstellungen zeigt sich der Mythos von der Unvereinbarkeit der Wissenschaft, der besagt, dass diese einzigartige Berufung nur unter Ausschluss aller anderen Lebensbereiche betrieben werden könne und damit Frauen aufgrund des ihnen gesellschaftlich zugeschriebenen lebensweltlichen Kontextes per se ausschlossen.
Wissenschafterinnen sahen sich herausgefordert, die Funktionsmechanismen und Praxen von Wissenschaft zu hinterfragen und zu erforschen, bewegten sich im Bereich von Gesellschaftskritik und Wissenschaftskritik und legten den androzentrischen Blick offen, der das Erkenntnisinteresse über die Jahrhunderte hinweg geleitet hatte. Inhalte und Logiken diverser Disziplinen wurden detaillierten Analysen unterzogen. Als wesentliche Basis neuzeitlicher Wissenschaft traten die mit der Dissoziation der Geschlechtscharaktere in Verbindung stehenden bipolaren Denkstrukturen zutage - die Konstruktion der Überlegenheit eines männlich konnotierten Geistes, der die weiblich konnotierte Natur zu beherrschen trachtete, trat zutage und führte die enge Verbindung von Geschlechter- und Wissensordnungen vor Augen.
Das ewige Klischee
An der Universität Wien setzte die Publikation "Das ewige Klischee" der Autorinnengruppe Uni Wien Anfang der 1980er Jahre ein wichtiges Zeichen im Bereich der Frauenforschung. Erstmals wurde hier Geschlecht als wesentliche Fragestellung in die akademischen Diskurse eingebracht. Thematisiert wurde die Situation von Frauen in unterschiedlichen historischen Perioden und Disziplinen, die Geschlechterrollenverteilung in der Gegenwart, Ausbildungsbedingungen, Fragen der Identität, der Repräsentation und der Sprache.
Anfang der 1990er Jahre fanden wesentliche Weiterentwicklungen in der auf dem Zweigeschlechtmodell - ein im 18. Jahrhundert entstandenes Phänomen, das Frauen und Männer als grundsätzlich unterschiedliche Wesen betrachtetet - basierenden Frauenforschung statt. Die Genusgruppe Frauen den Männern in der Vorstellung von jeweils homogenen Gruppen gegenüberzustellen, stellte sich in der sich entfaltenden Geschlechterforschung als zu vereinfachend heraus. Ein differenzierterer Blick auf die Mechanismen der Machtverhältnisse nahm die soziale Konstruiertheit von Geschlecht in den Fokus, bei der auch die soziale Zugehörigkeit wie der ethnische Kontext maßgeblich beteiligt sind.
Weitere Entwicklungen brachten Konzepte des doing gender sowie doing difference hervor, die Prozesse beschreiben, in dem Geschlecht mit all den es konstituierenden Dimensionen immer wieder hergestellt wird. Diese Zusammenhänge ließen die realitätsstiftenden Momente und die Realitätsmächtigkeit von Sprache und Kultur immer stärker hervortreten.
Gender Trouble
Zu Beginn der 1990er Jahre wurde prominent und mitunter durchaus kontroversiell das Konzept der Performativität von Geschlecht diskutiert, wie die diskursive Erzeugung von Geschlecht in "Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity" von Judith Butler postuliert wurde. Sie rückte in ihren Ausführungen den Handlungscharakter performativer Sprechakte, durch die Geschlecht hergestellt wird, in den Fokus.
Philosophisch verankert in Judith Butlers Politik des Subversiven entwickelte sich in der Folge die Queer Theory, die, klassische Geschlechts/Identitäten dekonstruierend wie destabilisierend viel Anregung bot, sie neu zu entdecken und damit eine Resignifikation des Symbolischen in Gang zu setzen.
Whose Science? Whose Knowledge?
In "Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives" hatte Sandra Harding, davon ausgehend, dass Frauen andere Erfahrungen als Männer in die Wissensproduktion einbringen würden, Anfang der 1990er Jahre die Wichtigkeit der Positioniertheit angesprochen. Positioniertheit auszuweisen wurde für feministische Wissenschafterinnen bzw. Gender Forscher_innen zum state of the art: Von wo aus stelle ich als Wissenschafter_in Fragen? Welche Bedeutung hat dabei meine Herkunft und kulturelle Eingebundenheit? Auf welchem Erdteil? Welcher geschlechtlichen Zuordnung fühle ich mich nahe und welchen Begehren? Welcher Generation gehöre ich an? Kurz, von welchem Standpunkt aus spreche ich.
Frauenforschung, feministische Forschung wie Gender Forschung bewirkten eine neue Aufmerksamkeit für die Beziehung zwischen der Wissensproduktion und ihren Akteur_innen, aber auch für die Paradigmen neuzeitlicher Wissenschaft, in denen sich die Denkverhältnisse einerseits präsentierten, andererseits aber auch herstellen. Dass Fakt und Fiktion, Fakt und Artefakt ursprünglich auf dieselbe sprachliche Wurzel zurückgehen und sich erst langsam auseinander zu entwickeln begannen, ist nur eines zahlreicher Beispiele, wie sich Denkordnungen entwickelten. Damit wurden erst die Voraussetzungen für die zu dieser Zeit ebenfalls stattfindende Trennung von Wissenschaft und Kunst geschaffen, oder von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, ein Prozess, der parallel zu dem der im bürgerlichen Denken strikten Trennung der Sphären von Frauen und Männern verlief. Dies ist nicht als Zufall zu betrachten.
Institutionalisierung
An der Universität Wien regte im Jahr 1994 eine Gruppe von ProfessorInnen – die Sozialwissenschafterin Irmgard Eisenbach-Stangl, der Ethnologe und Anthropologe Andre Gingrich, die Kunsthistorikerin Daniela Hammer-Tugendhat, die Romanistin Friederike Hassauer, die Philosophin Cornelia Klinger, die Soziologin und Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny, die Historikerin Edith Saurer, die Althistorikerin Edith Specht sowie die Sprachwissenschafterin Ruth Wodak – die Etablierung des Wissenschaftskollegs „Frauen- und Geschlechterforschung (Gender Studies)“ an. Ziel war ein mit NachwuchswissenschafterInnen mono- und transdisziplinär ausgerichtetes Projekt zur überfakultären Graduiertenförderung. Weitere profilierte Wissenschafterinnen aus dem Bereich der Gender Forschung wie die Historikerin Gabriella Hauch, die Physikerin und Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt, die Philosophin Alice Pechriegel die Sprachwissenschafterin Helga Kotthoff, die Soziologin Christine Goldberg sowie die Politikwissenschafterin Eva Kreisky waren in der Folge involviert. Dass noch Jahre bis zu einer Realisierung dieses Projekts vergehen sollten, erzählt die Geschichte der Gender-Dimensionen an der Universität Wien auf eine ihre spezifische Art und Weise im Spannungsfeld von Etablierung und Widerstand, Innovation und Restriktion.
Eine sechs Semester umfassende Studie, die 2004 präsentiert wurde, zeigte die Universität Wien, allen voran die Human- und Sozialwissenschaftliche sowie die Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät, als die europaweit mit dem größten Lehrangebot im Bereich der Gender Studies. Wichtige Arbeit zu deren Etablierung hatte die 1993 gegründete interuniversitärer Koordinationsstelle, das Projektzentrum Frauen- und Geschlechterforschung und deren Weiterführung in dem im Jahr 2002 ins Leben gerufenen Referat Genderforschung geleistet. Zu den Akteurinnen in diesem Bereich zählen u.v.a.m. Anette Baldauf, Marlen Bidwell-Steiner, Ingvild Birkhan, Sylwia Bukowska, Waltraud Ernst, Therese Garstenauer, Evi Genetti, Michaela Hafner, Brigitta Keintzel, Sabine Kock und Sabine Strasser.
Ab dem Studienjahr 2006/07 bietet die Universität Wien österreichweit als erste Universität ein Masterstudium für Gender Studies an. Auf der Ebene der Professorinnen wurde im Jahr 2010 eine Professur für Gender Studies geschaffen, die mit der Biologin und Wissenschaftsforscherin Sigrid Schmitz an der Fakultät für Sozialwissenschaften am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie besetzt und angesiedelt ist. Mit all diesen Aktivitäten bekennt sich die Universität Wien dezidiert zur im Entwicklungsplan festgehaltenen Antidiskriminierung und Geschlechtergleichstellung.